
 [rating=2]von Mainstream bis glanzvoll
[rating=2]von Mainstream bis glanzvoll
Jack Savoretti hat eine markante Stimme, die sicherlich nicht nur seine Hörerinnen zum Träumen bringt, sondern auch Männer erfreuen kann. Seine zehnjährige Laufbahn hatte letztes Jahr mit seinem Album „Written in Scars“ deutlich an Fahrt gewonnen. Es war das erste Album, mit dem Jack Savoretti Chart-Platzierungen schaffte.
Was lag also näher, als diesen Lauf fortzuführen? Insbesondere der Auftakt des Albums, die Singleauskopplung „When We Were Lovers“, klingt, als ob Savoretti und seine Produzenten zu sehr auf den schnellen Chart-Erfolg schielten. Es ist eine nette, aber letzlich seichte und austauschbare Midtempo-Softrock-Nummer.
Mehr zu sich selbst kommt der Sänger immer dann, wenn die üppige Instrumentierung und „Oh, oh“-Girl-Chöre zurückgefahren werden, wenn etwa wie in „I’m Yours“ die Folk-Rock-Wurzeln Savorettis kurz an die Oberfläche dürfen. Im Großen und Ganzen gelingt es dem Musiker und den Produzenten jedoch, sein Faible für Folk, Soft-Rock und Pop in einer gewissen Balance zu halten. Deutlich wird dies in „We are Bound“, das nach einem reduzierten Intro aber schnell wieder mit Geigen und Chöre angereichert wird.
Jack Savoretti schlägt sich wacker in seinem Bemühen, die eigene musikalische Identität nicht dem Kommerz zu opfern. „Sleep No More“ soll ein „Liebesbrief an seine Frau“ sein, meint der Künstler, zwölf Songs über „Dinge, die dich nachts wach bleiben und nicht mehr schlafen lassen“. Das kann der mit seinen Refrains clever gemachte Song über „Troubled Souls“ sein. Das Stück beschwingt und hat das Zeug zum Ohrwurm.
Überhaupt haben Savoretti und seine Komponisten und Produzenten ein feines Händchen für eingängige Melodien und gut gesetzte musikalische Einfälle. So besticht „Sleep No More“, der Titelsong, mit toller Phrasierung Savorettis, sparsamen Effekten – etwa eine gepfiffene Melodie – und dem transparentem Sound. „Any Other Way“ ist dagegen nicht mehr als Mainstreamradio, und „Start Living in the Moment“ variiert das Rezept nur ein weiteres Mal. Den glanzvollen Schlußpunkt setzt „Lullaby Loving“, bei dem sich der Folk-Rocker Savoretti fast aus dem goldenen Hitparaden- und Produzentenkäfig befreit.
So gesehen bleibt die musikalische Zukunft des Mannes ein wenig offen. Vielleicht macht er weiter mit den chartkompatiblen Liedern. Oder er bringt doch irgendwann ein sparsam instrumentiertes Folk-Rock-Album heraus. Wir werden sehen und hören.

 Sarajane ist eine illustre Persönlichkeit. Geboren in den Achtzigern, als Kind einer deutschen Mutter und eines englischen Vaters in der niedersächsischen Provinz, lebt sie seit einigen Jahren in Hamburg. Dies und mehr aus ihrem bewegten Leben als Sängerin erfährt das Publikum bei einem Konzert in ihrem Wohnzimmer, dem Hamburger Club „Knust“. Der verströmt den Charme einer renovierungsbedürftigen Garage, was erst mal so gar nicht zum exaltierten Auftritt Sarajanes passen will.
Sarajane ist eine illustre Persönlichkeit. Geboren in den Achtzigern, als Kind einer deutschen Mutter und eines englischen Vaters in der niedersächsischen Provinz, lebt sie seit einigen Jahren in Hamburg. Dies und mehr aus ihrem bewegten Leben als Sängerin erfährt das Publikum bei einem Konzert in ihrem Wohnzimmer, dem Hamburger Club „Knust“. Der verströmt den Charme einer renovierungsbedürftigen Garage, was erst mal so gar nicht zum exaltierten Auftritt Sarajanes passen will.






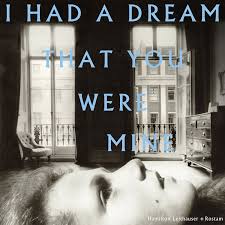 [rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop
[rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop






