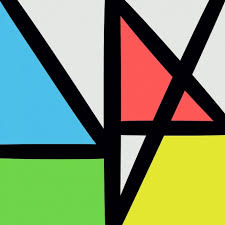[rating=3] Erstaunlich Reifes aus der Provinz
[rating=3] Erstaunlich Reifes aus der Provinz
Was bedeutet Rockmusik heute? Ein gigantisches Geschäft, Konzertarenen, in denen man für viel zu viel Geld die Band des Abends auf grobkörnigen Videoleinwänden sehen kann. Oder wahlweise Mehrzweckhallen mit mieser Akustik und überhöhten Getränkepreisen. Irgendwo in weiter Ferne stehen alte Männer auf der Bühne und spielen die Songs unserer Jugend. Das ist alles recht traurig, erfüllt aber offenbar seinen Zweck.
Dann kommt wieder eine Platte wie „Humboldt Park“ ins Haus, von einer deutschen Band namens Planeausters. Aus Ravensburg! Hier ist das Ergebnis umgekehrt zum abgeschmackten Rockzirkus: Man erwartet wenig und wird aufs Angenehmste überrascht. Nicht, dass die Planeausters die Zukunft des Rock’n’Roll verkörperten oder mit ungehörten Ideen aufwarteten. Die drei Jungs machen es so wie viele andere junge Bands. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten, sie spielen ihre Songs, und beide nehmen eine mit auf eine Reise. Sänger und Gitarrist Michael Moravek hat sich durch den goßen Fundus amerikanischer Singer-Songwriter gehört und kann bei Bedarf auch den jungen Dylan zu neuem Leben erwecken – wie etwa in „Stranger in a Stranger’s Clothes“, das beinahe klingt wie His Bobness 1969. Der Song „Never Forget“ erinnert dagegen an amerikanischen Desert-Rock; er funktioniert prächtig und wirkt weit weniger epigonal als man zunächst denkt.
Moravek und seinen beiden Mitmusikern gelingt mit „Humboldt Park“ das Kunststück, Altes und Bekanntes mit Neuem zu einem eigenständigen Klang zu vermischen. Das liegt unter anderem daran, dass der Mann überzeugend Geschichten erzählen kann. Hinzu kommt, wie in „Wouldn’t say it’s over“ oder „The Golden Days of Missing you are over“, ein gewisser lakonischer Humor. Dazu sind Gesang und Musik angenehme unaufgeregt. Sicher, Moraveks Gesang zeigt ab und an noch zu sehr seine Bewunderung für Mike Scott von den Waterboys. Und mitunter weisen nicht nur Gitarrensound, Bass und Drums, sonder auch Melodien und Songaufbau deutliche Anklänge an große Vorbilder auf. Trotzdem: Für die relativ junge Band aus Ravensburg ist das mehr als respektabel.
Eingespielt wurde „Humboldt Park“ in Chicago, in einem Studio, das sich in der Nähe des Humboldt Parks befindet – einem jener Orte, die man bei Einbruch der Dunkelheit dem Vernehmen nach meiden sollte. Die Themen der Planeausters sind trotzdem weniger urbane Gewalt oder die Hektik der Großstadt. Ihre Musik folgt eher dem Kompass der Sehnsucht nach Freiheit und Weite, also uramerikanischen Mythen. Und ihre Texte thematisieren die ewige junge Erfahrung von Liebe und Enttäuschung, drehen sich also um das große Ganze, das sie mit einer angenehmen Mischung aus Humor und Melancholie präsentieren.
Die Arrangements sind allerdings überwiegend sparsam: Hier spielen überwiegend drei Typen Gitarre, Bass, und Schlagzeug, und einer singt. Und auch wenn man gelegentlich eine Mundharmonika, eine Orgel und auch mal eine Trompete hört, wirkt nichts überfrachtet.