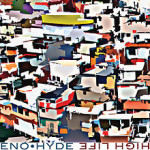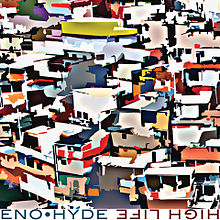[rating=2]Netter Folk-Pop mit geringem Tiefgang.
[rating=2]Netter Folk-Pop mit geringem Tiefgang.
Lily and Madeleine fahren Boot – beziehungsweise: Sie liegen verträumt in einem Ruderboot, das auf ruhigen Gewässern treibt. Schön anzusehen, die sich räkelnden jungen Damen.
Keine Spur von ‚giftigen Dämpfen‘ („Fumes“), nirgends, nicht ein Hauch von Gefahr. Stattdessen dominieren wie schon beim letztjährigen Debüt der beiden Schwestern zuckersüße Harmoniegesänge. Tolle Stimmen, keine Frage, wenn auch mit typisch amerikanischem Zungenschlag, was die Art und Weise des Gesangs anbelangt. Das können die beiden.
Im Ergebnis bekommt der Hörer eine Mischung aus radiokompatiblem Pop und Folk-Pop light, teils opulente Ararrangements, stimmlichen Wohlklang und eher harmlose Texte, die problemlos auch auf Radiostationen des mittleren Westens gut ankommen dürften. Auch eine verhallte Prise Lana del Rey fehlt nicht. Ist das nicht ein bißchen viel?
Schon der Karrierstart der siebzehn und neunzehn Jahre alten Damen aus Indianapolis mutet an wie am Reißbrett von einem cleveren Produzenten erdacht. Der Legende nach stellten Lily und Madeleine selbst produzierte Videos bei Youtube ein, die – Überraschung! – nicht nur sehr gut waren, sondern auch massenhaft angeklickt worden sein sollen. Danach kam es, wie es kommen musste: Ein lokaler Produzent – Paul Mahern, der unter anderem für John Mellencamp gearbeitet hat – wurde auf sie aufmerksam. Mit Hilfe des Songwriters Kenny Childers, ebenfalls in Bloomington, Indiana ansässig, entstanden etliche Songs und bald folgte das Debutalbum.
Auch wenn „Fumes“ ohne diese beiden und ohne die Mitwirkung ungenannter, versierter Studiomusiker nicht denkbar wäre, sind Lily and Madeleine wohl keine Marionetten in Händen abgezockter Manager und Produzenten. Dafür stehen sie in den zehn Songs des Albums doch zu sehr im Mittelpunkt. Jedoch offenbart das Cover vielleicht unfreiwillig, daß andere die Ruder in der Hand zu halten scheinen, während ‚Lil and Mad‘ versonnen übers tiefe Wasser gleiten. Hoffentlich zieht kein Sturm auf …
Auch wenn ihrer Musik (noch) die unverwechselbare Handschrift fehlt – Ecken und Kanten leider ebenso –, versöhnen der stimmliche Wohlklang und die entspannte, leicht wehmütige Stimmung des Albums. Das ist für Herbsttage, golden oder regnerisch und stürmisch, ganz nett.