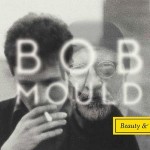[rating=2]Streckenweise überzeugend, in anderen Momenten beliebig
[rating=2]Streckenweise überzeugend, in anderen Momenten beliebig
Archive gehörten seit ihrer Gründung 1994 durchweg zur Regionalliga der britischen Musikszene. Die Gründe mögen häufige Besetzungswechsel, ein hörbarer Mangel an eigenständigen musikalischen Ideen oder einfach der Umstand gewesen sein, daß es stets bessere andere Bands des gleichen Genres gab. Ihr neues Album „Restriction“ ist keineswegs geeignet, dies nachhaltig zu ändern, was ein wenig schade ist. Immerhin bietet es einige überraschende Momente, so etwa im Eröffnungssong „Feel it“, auf dem New-Wave-Schrammel-Gitarren aufs Angenehmste das Synthie-Gewaber und die klagende Stimme unterbrechen. Aber bereits im Titelsong des Albums, „Restriction“ langweilen die Herrschaften mit Endlos-Klangschleifen und repetetiven Rhythmen. Der dritte und vierte Song, „Kid Corner“ und „End of our Days“, klingen wie aus dem Archiv von Morcheeba – aber die hatten sowohl bessere Synthies als auch mehr Pop-Appeal.
Die Sänger wechseln sich ab, die Klänge und Ideen ebenso. Das wäre nicht schlecht, wenn man nicht ständig das Gefühl hätte, dass sich die Akteure allzu häufig aus dem Fundus bekannter Arrangements, Ideen und Klängen anderer Leute bedienten. Vielleicht heißt die Band deshalb Archive?
Wir wollen jedoch nicht ungerecht sein. Wie die Band auf „Third Quarter Storm“ den schnulzigen Wohlklang durch Lärm-Einschübe stört, ist ganz hübsch. Und wenn auch das Getrommel auf „Ride in Squares“ nicht wirklich neu ist, so gefällt es dennoch. Dagegen langweilen Titel wie „Crushed“, denn eine wirkliche Idee oder auch nur etwas Spannendes konnte ich darin nicht ausmachen. Dafür versöhnt das irgendwie an Bond-Titelsongs (aus der Adele-Phase) erinnernde Ballade „Black and Blue“ ein bißchen. Den Abschluß bilden zwei längere Titel: „Greater Goodbye“ und „Ladders“, die „Restriction“ jedoch nichts mehr Wesentliches hinzufügen, sondern erneut den Bogen von Lärm zu Pop und zurück schlagen – große Momente inklusive. Am Songwriting sollten „Archive“ aber weiter arbeiten und vielleicht beim nächsten Mal versuchen, sich ein wenig stärker zu fokussieren. Aber fürs Durchhalten seit 1994 gibt’s einen Extra-Bonus.