
 [rating=3] Selbstbewusst ins richtige Licht gesetzt
[rating=3] Selbstbewusst ins richtige Licht gesetzt
Aus Widrigkeiten Profit schlagen: Ihre hürdenreiche Anreise nach Belgrad, wo sie in der Wohnung von Freunden zwei Wochen lang Lieder schreiben wollten, haben die Liedermacherin Desiree Klaeukens und Dietrich Brüggemann, im Hauptberuf Regisseur und Drehbuchautor, gleich zu einem Stück verwurstet. Sie scheinen Spaß an allem zu haben, was schief gehen kann, und geben schon mit dem Auftakt („Getriebeschaden“) einen Hinweis darauf, dass Aufzählungen ihr beliebtes Stilmittel ist. Meist setzen sie es ganz originell ein.
Die Musik des Duos ist nicht vom Himmel gefallen: In „Kunst“, klingt Brüggemanns Stimme nach dem frühen Frank Spilker, die schwermütigen Refrains von „Nicht dein Typ“ und „Mama, schick mir die Platten von Reinhard Mey“ wirken wie von der Hamburger Band Die Heiterkeit geliehen.
Es ist leicht, das Duo in der deutschen Indie-Pop-Geschichte zu verorten, die sie um einige vergnügliche, mal flotte, mal getragene Songs bereichern. Diese könnten sie im Liedermacherstil inszenieren. Mit Golo Schultz (Bass) und Florian Holoubek (Schlagzeug) hat sich das Duo jedoch zwei Mitstreiter geholt, und damit es weniger nach Reinhard Mey im Duett mit Jenny Jürgens klingt die Chose mehr in Richtung Indie-Pop gedreht.
Das kommt ganz gut, auch wenn Schönheit in erster Linie im Auge des Betrachters liegt und in zweiter nach der richtigen Beleuchtung verlangt. „Ich sehe auch gut aus“, heißt es ganz selbstbewusst in „Nicht dein Typ“ – vor der selbsteinsichtigen Einschränkung: „es ist nur eine Frage des Lichts“. Das gilt ja, wenn man das Selbstbild nicht mit rosaroter Brille über das Zulässige hinaus korrigiert, für die meisten Menschen. Theodor Shitstorm wissen das – und als veritable Beleuchtungskünstler gelingt es ihnen immer wieder, dass man über den bescheuerten Namen hinwegsehen und sogar die Aufzählungsmarotte immer wieder originell finden kann.
→ Facebook-Seite von Theodor Shitstorm
(Foto: Staatsakt)

 [rating=4] Anrührende Lieder einer originellen Alleinunterhalterin
[rating=4] Anrührende Lieder einer originellen Alleinunterhalterin
 [rating=2] Ein Album für gewisse Stunden
[rating=2] Ein Album für gewisse Stunden

 „Vergesst das Morgen“, fordert Falco in seinem hedonistischen „Junge Römer“, auch wenn er darauf anspielt, dass am nächsten Tag die Rechnung folgen wird. Der schillernde Musiker hat den Song mit großem Orchester eingespielt. Garish bringen als Zugabe ihres frenetisch umjubelten Konzerts die Lagerfeuer-Version. Ihre zehn Jahre alte, nachdenkliche Interpretation des Liedes, das die diesem innewohnende Katerstimmung nach dem Fest betont, ist bezeichnend. So selbstbewusst Falco aufgetreten ist, so zurückhaltend geben sich Garish. Falcos exaltierter Virilität steht die gefühlvolle Inbrunst gegenüber, die zumindest Sänger Thomas Jarmer gelegentlich zelebriert. Der Rest der Truppe gibt den stillen Handwerker.
„Vergesst das Morgen“, fordert Falco in seinem hedonistischen „Junge Römer“, auch wenn er darauf anspielt, dass am nächsten Tag die Rechnung folgen wird. Der schillernde Musiker hat den Song mit großem Orchester eingespielt. Garish bringen als Zugabe ihres frenetisch umjubelten Konzerts die Lagerfeuer-Version. Ihre zehn Jahre alte, nachdenkliche Interpretation des Liedes, das die diesem innewohnende Katerstimmung nach dem Fest betont, ist bezeichnend. So selbstbewusst Falco aufgetreten ist, so zurückhaltend geben sich Garish. Falcos exaltierter Virilität steht die gefühlvolle Inbrunst gegenüber, die zumindest Sänger Thomas Jarmer gelegentlich zelebriert. Der Rest der Truppe gibt den stillen Handwerker.
 [rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt
[rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt

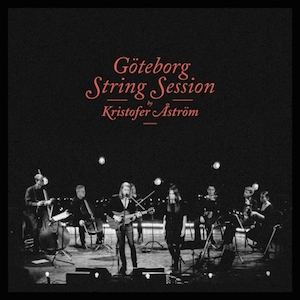

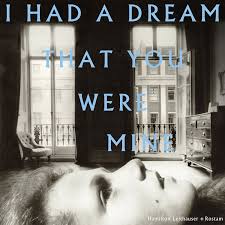 [rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop
[rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop
