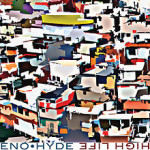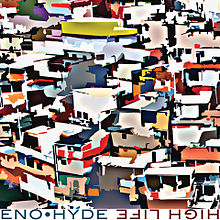Erinnert an Gitarrenbands der leiseren Sorte, setzt aber auch eigene Akzente.
Die Small Time Giants kommen aus Grönland und sind eine der Lieblings-Rockbands dieser Insel. Was das im internationalen Pop-Zirkus bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Wer „Big in Greenland“ ist, könnte genau so gut Popstar auf Pluto sein. Einerseits.
Andererseits eröffnet eine solche Nischenexistenz ungeahnte Möglichkeiten. Auch Zwerge haben einmal klein angefangen. Und: Größe allein besagt gar nichts. Immerhin hat es die vier Jungs unterdessen nach Kopenhagen verschlagen, was verglichen mit Grönland schon hautnah am Puls des Pop ist. Und so dauerte es auch ’nur‘ ein Jahr, bis ihre Debut-CD auch ausserhalb Grönlands und Dänemarks erhältlich ist.
Genug der Vorreden. Entscheidend ist immer noch, was hinten, also aus den Lautsprechern raus kommt. Grönland muss eine grundentspannte Insel sein, mit einem gehörigen Schuss Melancholie im Gemüt der Insulaner. Die Musik der Small Time Giants auf „Stehthoscope“ erinnert sicher nicht von ungefähr an
britische Indie-Gitarren-Bands der leiserern Sorte.
Die Vorbilder sind noch recht präsent. Aber die Jungs haben ein feines Gespür für Melodien und für dramatischen Song-Aufbau. Lead-Sänger Miki Jensen gelingt es gut, Emotionen und Stimmungen zu transportieren, wie in „Undiscovered Potential“, wo es hoffnungsvoll heisst: „We know every Flower will grow through Concrete“. Beinahe Hit-Potential – auch ausserhalb von Grönland – hat der Song „A Basement with a View“, der wie die meisten Titel auf beinahe naive Weise verhaltenen Optimismus verkörpert.
Musikalisch pendelt die Band irgendwo im Pop-Kosmos zwischen hallenden Gitarren, stellenweise opulenten orchestralen Keyboard-Melodien, Computer-gestützten Drums und einer angenehmen Stimme des Sängers. Jener mangelt es zwar an Tiefe und Variationsbreite, aber welcher Pop-Sänger kann das schon für sich in Anspruch nehmen? Wie bei vielen Platten-Debüts üblich, fehlt noch Routine. Die eingeschlagene Richtung ist noch nicht völlig ausdefiniert, und Änderungen im Sound sind vorstellbar. Wer jedoch eine nette Indie-Pop-Platte hören möchte, die zwischen einer Art post-adoleszenten Melancholie mit optimistischem Ausblick changiert, ist hier richtig. Die Small Time Giants treten mit ihrem Debüt sympathisch und bescheiden auf, ohne große Geste und ohne Anspruch, den Pop neu zu erfinden. Beim nächsten Mal darf es aber ruhig auch mal ein wenig dynamischer zur Sache gehen. Jetzt, im nebligen November, bieten sie die richtige Mischung.