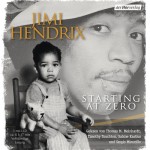Das haben wir alles schon gehört: Grobe Rückkoppelungen, die weit weniger interessant sirren als noch bei Jimi Hendrix; hinausgeschriene oder sprechgesungene Texte, die vergleichsweise lange und simple Instrumentalpassagen nur kurz unterbrechen. Doch die Schwaben, der Name scheint Programm zu sein, treffen den Nerv und heben sich – wenn man das bei derart roher Musik sagen darf – wohltuend von den Indie-Rockern ab, deren Musik mehr vom Zeitgeist als vom musikalischen Selbstverständnis geprägt ist.
Das haben wir alles schon gehört: Grobe Rückkoppelungen, die weit weniger interessant sirren als noch bei Jimi Hendrix; hinausgeschriene oder sprechgesungene Texte, die vergleichsweise lange und simple Instrumentalpassagen nur kurz unterbrechen. Doch die Schwaben, der Name scheint Programm zu sein, treffen den Nerv und heben sich – wenn man das bei derart roher Musik sagen darf – wohltuend von den Indie-Rockern ab, deren Musik mehr vom Zeitgeist als vom musikalischen Selbstverständnis geprägt ist.
Dass ihre Texte kaum zu verstehen sind, der Bass nicht annähernd so schön knallt wie auf dem Album und auch sonst der Klang zu wünschen übrig lässt: Es tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Wären Die Nerven Fotografen, so würden sie keine geleckten Bilder machen, sondern unscharfe und verwischte – atmosphärische Momentaufnahmen, die technisch mangelhaft sein mögen, aber umso mehr Ausstrahlung besitzen.
Das Trio geht kühl und doch engagiert zur Sache. Wenig Interaktion mit dem Publikum, wenig untereinander. Man freut sich eher im Stillen, wenn ein Übergang klappt oder der eher diffizile Abschluss eines Stückes.
Das von wem auch immer vergebene Attribut „Hipsterband für alte Szenesäcke“ führt das Trio auf ihrer Webseite als eine ihrer Lieblingsbezeichnungen auf. Tatsächlich erinnern Die Nerven an die Endsiebziger No-Future-Bands. „Was auch immer wir jetzt lernen, ist mit Sicherheit nicht wichtig/Was auch immer wir jetzt lernen, ist mit Sicherheit egal“, konstatieren sie nüchtern in ihrem Song „Albtraum“ und dass sie nichts mehr erwarten. Dazu passen der rohe Klang und der immer wieder schwerfällige Rhythmus genauso wie ein Auftritt, der frei von Attitüden ist.
Noch hat sich offenbar nicht herumgesprochen, dass die Musik des Trios auf der von Bands wie Sonic Youth und Joy Division aufbaut. Es sind kaum „alte Szenesäcke“ da, für die ihre Musik sein soll. Das Publikum der Nerven ist überwiegend jung wie sie selbst. Doch bestehen können sie auch vor älteren Semestern – geht alle hin und hört.
→ Offizielle Homepage von Die Nerven und ihr Tourplan
(Foto: TheNoise)