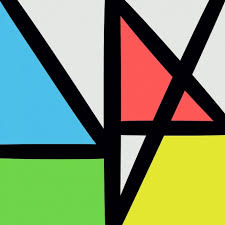[rating=2] Unterhaltsam
[rating=2] Unterhaltsam
Erinnert sich noch jemand an No Doubt, die Combo um die sehr blonde Sängerin Gwen Stefani? Hier sind drei ihrer Mitstreiter mit neuem Sänger: Tom Dumont an der Gitarre, Tony Kanal an Keyboards und Bass, Adrian Young am Schlagzeug – also drei Viertel von No Doubt – und als Sänger Davey Havok, der als Punker bei den hierzulande eher unbekannten Bands AFI und Blakq Audio gesungen hat. Jetzt sieht er ein wenig aus wie Russel Mael von den Sparks. Schnurrbärte sind schon länger wieder salonfähig, jetzt anscheinend auch die Achtzigerjahre. Soviel 80er-Sound in einer brandneuen Produktion war selten. Wer „Kill for Candy“ hört, meint sofort, dass wir wieder 1981 haben. Handelt es sich hierbei um Ironie oder um eine Art historisch-kritischer Aneignung des britischen New Wave mit Bands wie ABC, Culture Club, Duran Duran oder A Flock of Seagulls? Eher nicht.
Dreamcar meinen das anscheinend ernst. So bekennt Tony Kanal sich in einem Interview mit dem Rolling Stone zwar einerseits zu den deutlich hörbaren musikalischen Einflüssen, behauptet jedoch gleichzeitig tapfer, man habe etwas Neues geschaffen. Davon kann über weite Strecken des Debütalbums zwar keine Rede sein, aber weil die vier Musiker und ihre Helfer Profis sind, legen sie eine sorgfältig eingespielte und produzierte Platte vor. Diese ist durchaus eingängig und unterhaltsam, wobei für ältere Hörer noch ein gewisser Déjà-vu-Effekt hinzukommt. Man kennt die verschatteten, durch Echo-Effekte gejagten Gitarren, die Power-Drums, den Slapping-Bass und die üppigen Keyboards noch von den oben genannten Bands. Deren oft vorwärts treibenden Rhythmus hat man passenderweise gleich mit übernommen. Sänger Davey Havok hat seine Punk-Vergangenheit nicht nur optisch hinter sich gelassen, sondern beherrscht auch den Gesangsstil eines Martin Fry von ABC. Er setzt aber wenig eigenständige Akzente und fügt sich somit nahtlos ins Sound-Konzept von Dreamcar.
Wer aber braucht so etwas? Ältere mögen sich nostalgisch an ihre musikalische Früherziehung erinnern, für jüngere mögen Dreamcar gar neuartig wirken. Amerikanische Musikmagazine wie Billboard und Rolling Stone raunen von einer Supergroup, aber das kann man getrost unter Marketing-Geklingel verbuchen. Für ein New Wave-Revival wird es vermutlich nicht reichen, aber ganz unterhaltsam ist das Debut von Dreamcar schon geworden.
(Cover: Sony Music)