
 [rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt
[rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt
Mit „Paradise“ legt die kanadische Sängerin und Musikerin Jenn Grant ihr nunmehr sechstes Album vor. Zumindest in unseren Breiten blieb die Dame bislang eher unbeachtet, wenngleich sie auch in Europa fleißig tourte. Ob sie mit ihrem neuen Album größere Aufmerksamkeit erlangen wird, ist ungewiss. „Paradise“ entstand in intensiver Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann und Produzenten in ländlicher kanadischer Abgeschiedenheit. Allerdings hören wir hier keine folkloristische Versponnenheit fernab der Klänge der Metropolen, sondern eine durchaus gefällige Mischung aus verträumten Popsongs, Balladen und im weiteren Sinne Singer/Songwriter-Werken. Grant äußert zwar tapfer, dass sie mit ihrem neuen Opus in bislang unbekannte klangliche ‚galaktische Gefilde‘ vorstoßen möchte, aber das dürfen wir getrost unter Marketing-Geklingel verbuchen. Auch wenn sie, scheinbar selbstkritisch und zufrieden zugleich, bekennt, dass sie nun endlich ihrer eigenen stimmlichen Möglichkeiten gewahr werde, muss das niemand erschrecken. Die elf zumeist im Mid-Tempo gehaltenen Songs schielen unverhohlen auf Radiotauglichkeit – und das klappt auch. Jenn Grant ist gut bei Stimme. Doch diese ist nicht unverwechselbar. So oder ähnlich hat man schon etliche Sängerinnen gehört. Die Musik fällt auch nicht aus dem Rahmen, sondern bedient sich der handelsüblichen Zutaten mit einer Prise Synthies und Geigen hier, elektrischem Klavier dort und zu allem hübsche Melodien. Das ist ganz gut gemacht und dringt in die Gehörgänge, setzt sich dort aber nicht wirklich fest.
Fazit: Für Jenn Grant mag „Paradise“ ein Meilenstein ihrer musikalischen Entwicklung sein. Für den Hörer ist es eine weitere, gut gemachte Pop-Platte, die beim Hören durchaus ihre Wirkung zu entfalten vermag.
→ Offizielle Homepage von Jenn Grant
(Cover: Star House)

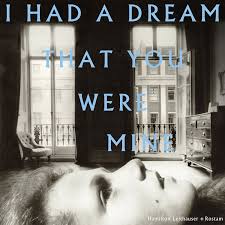 [rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop
[rating=4] Reminiszenz an die goldene Zeit des amerikanischen Pop




 [rating=3]Der Belgier Milow scheint ein Optimist zu sein, oder aber zumindest ein moderner, aufgeklärter Mann.
[rating=3]Der Belgier Milow scheint ein Optimist zu sein, oder aber zumindest ein moderner, aufgeklärter Mann.



