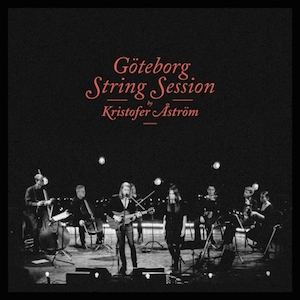[rating=3] Typisch Wader – als Kompliment gemeint
[rating=3] Typisch Wader – als Kompliment gemeint
Er sei die lange Zeit seiner Karriere ein „aufrechter Künstler“ gewesen, der „wichtige, hinreißende, herzöffnende Lieder“ geschrieben habe, lobt sein Bruder im Geiste, der nur wenige Jahre jüngere Konstantin Wecker, Hannes Wader bei seinem Abschied von der Bühne. Die beiden haben – auch gemeinsam mit der dritten deutschen Liedermacherinstanz dieser Generation, Reinhard Mey – oft zusammen auf der Bühne gestanden. Doch bei seiner letzten Tournee präsentierte sich Hannes Wader wie in seinen Anfängen alleine dem Publikum. Und man kann es sich nicht anders vorstellen, als dass jedes Konzert ein Heimspiel gewesen ist.
„Meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals, frei und leicht“, singt Wader gleich im zweiten Stück seiner Abschiedstournee („Damals“) und mag damit recht haben. Es ist kein Wunder, dass der 75-Jährige nicht mehr über die strahlende Stimme des Mittzwanzigers verfügt. Aber auch heute noch ist sie unverkennbar, klingt immer noch angenehm weich und – ja, überraschend jung. Und auch die Gitarre zupft er immer noch ansprechend.
So treu sich Wader als Person geblieben sein mag und so einheitlich sein musikalisches Schaffen wirkt: Die Bandbreite seiner Lieder ist beträchtlich – von dezidiert sozialkritischen über schräg-humoristische und poetische bis hin zu Volksliedern. Der Liedermacher bringt erwartungsgemäß von allem etwas und kann damit wohl die meisten Fans glücklich machen. Und gleichzeitig wird den meisten mehr als ein Lied fehlen – er hat schlicht zu viele gute geschrieben oder adaptiert, um sie in einem Konzert unterzubringen.
→ Bisherige Rezensionen zu Hannes Wader auf schallplattenmann.de und im Blog.
→ Offizielle Homepage von Hannes Wader
(Foto: Qrious)

 [rating=2] Hart am Rand der Klischees
[rating=2] Hart am Rand der Klischees
 Kann in andere Sphären tragen [rating=4]
Kann in andere Sphären tragen [rating=4]
 Konventionell, aber unterhaltsam
Konventionell, aber unterhaltsam