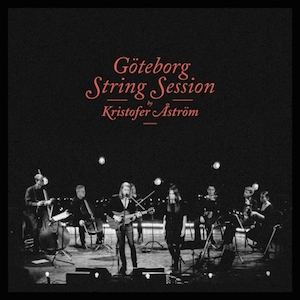[rating=3] Getragen, ruhig, beschaulich
 Sternlumen sind Thomas Kudela und sein Steinway-Flügel. Kudela ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Kopenhagen. Genauer: im Stadtteil Norrebro. Mit der vorliegenden Hommage an sein Viertel legt Sternlumen sein zweites Album vor. Zu hören gibt es Solopiano und sonst nichts. Wer dabei an Keith Jarrett oder Chick Corea denkt, liegt nicht ganz falsch, obwohl Kudela einen eigenen Ansatz verfolgt.
Sternlumen sind Thomas Kudela und sein Steinway-Flügel. Kudela ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Kopenhagen. Genauer: im Stadtteil Norrebro. Mit der vorliegenden Hommage an sein Viertel legt Sternlumen sein zweites Album vor. Zu hören gibt es Solopiano und sonst nichts. Wer dabei an Keith Jarrett oder Chick Corea denkt, liegt nicht ganz falsch, obwohl Kudela einen eigenen Ansatz verfolgt.
Ähnlich wie bei den Genannten liegt liegt das Augenmerk auf Klang und Stimmung. Eingespielt wurden die Titel live in einem Kopenhagener Studio – unter hohen Qualitätsansprüchen, um den unvergleichlichen Klang des Flügels entsprechend einzufangen. Das ist gelungen. Damit enden die Vergleiche mit den ‚Göttern‘ des Solopianos aber auch beinahe. Kudela steht sicher in deren Tradition, was in diesem Genre gewissermaßen unausweichlich ist, markiert aber eigene Klangspuren. Die erinnern mal an Saties Pianostücke oder erzeugen eine romantische Stimmung wie bei Schumann. Trotzdem sollte man dem jungen Künstler kein Epigonentum vorwerfen. Seine Stücke sind getragen und, neben einigen dramatischen Momenten, im besten Sinne entschleunigt, aber nie temperamentlos.
Es verwundert nicht, daß auf dem Cover der CD steht: „Sternlumen is Thomas Kudela and a Piano“ – denn das Instrument ist ein unverzichtbarer Mitspieler.“Norrebro Nights“ mit seinen nur sechs Titeln wie „Red Wine Melancholia“, „Neon Lakes“ oder „Morgendämmerung“ eignet sich wunderbar dafür, dem alltäglichen Hamsterrad des Großstadtdaseins zu entfliehen. Weniger geeignet ist die Platte zum Nebenbeihören, obwohl man sich manchen Titel in Auszügen auch gut auf einem U-Bahnhof bei Morgenanbruch anhören könnte. Man wäre vermutlich nach wenigen Augenblicken der funktionellen Umgebung entrückt, sofern man der Musik Raum zur Entfaltung lässt.
Die getragenen, ruhigen und eine beschauliche Stimmung verströmende Musik von Thomas Kudela kann cinematographische Eindrücke hervorrufen – und so manches Ostinato transportiert die dunklen Herbststimmungen, der kommenden Tage.Hörenswert.
(Cover: Gateway Music)

 [rating=2] Hart am Rand der Klischees
[rating=2] Hart am Rand der Klischees
 [rating=2] Ein Album für gewisse Stunden
[rating=2] Ein Album für gewisse Stunden
 Kann in andere Sphären tragen [rating=4]
Kann in andere Sphären tragen [rating=4]
 [rating=2] Unterhaltsam
[rating=2] Unterhaltsam
 Konventionell, aber unterhaltsam
Konventionell, aber unterhaltsam



 [rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt
[rating=2] Unverhohlen auf Radiotauglichkeit getrimmt