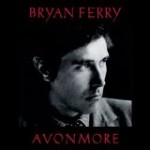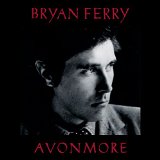Was ist wichtig, wenn man ein Leben erzählt? Was müssen wir wissen, über Herkunft oder Bildungsweg, welche Lebensdaten kennen, um eine Person zu erfassen, ihre Gedanken, Einstellungen und Sehnsüchte? Mathieu Amalric stellt das alles nicht in den Vordergrund. Er nähert sich „der schönsten Stimme Frankreichs“ atmosphärisch und skizziert die Lebensgeschichte von Barbara indirekt. Er erzählt, wie seine Protagonisten, der Regisseur Yves und die Schauspielerin Brigitte, der Ikone bei der Suche nach ihrem Wesen immer mehr verfallen.
Was ist wichtig, wenn man ein Leben erzählt? Was müssen wir wissen, über Herkunft oder Bildungsweg, welche Lebensdaten kennen, um eine Person zu erfassen, ihre Gedanken, Einstellungen und Sehnsüchte? Mathieu Amalric stellt das alles nicht in den Vordergrund. Er nähert sich „der schönsten Stimme Frankreichs“ atmosphärisch und skizziert die Lebensgeschichte von Barbara indirekt. Er erzählt, wie seine Protagonisten, der Regisseur Yves und die Schauspielerin Brigitte, der Ikone bei der Suche nach ihrem Wesen immer mehr verfallen.
Yves Zand, gespielt von Almaric selbst, dreht als obsessiver Verehrer einen Film über die französische Sängerin Barbara. Seine Darstellerin folgt ihm in die Obsession und findet aus ihrer Rolle nicht mehr heraus. Die Ebenen überlagern sich. Wann Barbara für den Dreh gespielt wird und wann Brigitte im Leben zu Barbara wird, ist oft nur schwer auseinanderzuhalten. Und das, obwohl der Regisseur durch Einstellungen und unterschiedliches Filmmaterial – die Szenen mit Barbara wirken historisch, alle anderen sind zeitgemäß brillant – durchaus Hilfestellungen gibt. Zudem werden auch Originalaufnahmen mit der ausdrucksstarken Sängerin geschickt eingebaut.
Almarics Herangehen kann man als verkopft abtun oder als besondere Referenz an die ausdrucksstarken poetischen Texte Barbaras interpretieren. Und die Obsession von Yves und Brigitte entspricht der Besessenheit Barbaras für ihre Lyrik und Musik.
Barbara war – glaubt man dem Film – eine Diva, schwierig und eigensinnig. Welche Lebenserfahrungen dem zugrunde liegt, eröffnet der Film nicht. Führt man sich die im Film rezitierten Texte von Barbara vor Augen, ist es jedoch gut und richtig, dass Mathieu Almaric ganz auf Poesie und Charisma setzt. Denn die unmittelbare psychologische Deutung ist in einer konventionellen Biographie besser aufgehoben. Das passende Schlusswort sagt Jeanne Balibar als Brigitte als Barbara: „Das ist fantastisch! Wie violetter Regen auf finsteren Bergen.“
→ „Barbara“ in der IMDB
→ Wikipedia-Eintrag der Chansonsängerin Barbara
(Foto: Diagonal)

 Struwwelpeterschauerliche Mischung
Struwwelpeterschauerliche Mischung
 [rating=4] liebevoll hintersinnig, kritisch, bissig, charmant
[rating=4] liebevoll hintersinnig, kritisch, bissig, charmant