
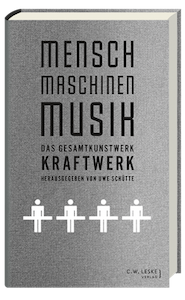 Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.
Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.
Die Moma-Konzertreihe wurde in Museen anderer Länder wiederholt. Der Literaturwissenschaftler und Musikjournalist Uwe Schütte initiierte 2015 in Birmingham und Düsseldorf (im Umfeld der Konzerte in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) wissenschaftliche Konferenzen und legt nun eine umfassende Bestandsaufnahme zum – wie es im Untertitel heißt – „Gesamtkunstwerk Kraftwerk“ vor.
Er geht dabei chronologisch vor und lässt seine Gastautoren Aspekte der jeweiligen Phasen beziehungsweise Alben beleuchten. Das reicht vom Frühwerk im Krautrock-Kontext über die einzelnen Alben („Autobahn“, „Radio-Aktivität“, etc.) bis hin zum „Katalog-Komplex“, der Zusammenfassung der acht Kraftwerk-Alben (2009) und zur späteren 3D-Retrospektive (2012).
In einem zweiten, „Diskurse“ genannten Teil dieser „Kraftwerkstudien“ geht der Band Themen wie den Texten der Gruppe, ihren Sound-Topographien oder der internationalen Ausstrahlung auf den Grund.
Die in „Mensch – Maschinen – Musik“ präsentierten Themen sind naheliegend. Die Texte erheben wissenschaftlichen Anspruch, sind dabei jedoch überwiegend so geschrieben, dass auch interessierte Nicht-Akademiker nur gelegentlich Wortbedeutungen nachschlagen müssen. Ohnehin sind nicht alle Analytiker dem akademischen Ansatz verpflichtet. (Ja, Analytiker: Die Kraftwerk-Analyse ist fest in männlicher Hand, nur zwei von 15 Texten stammen von Frauen.) Der Sammelband ist auf die Würdigung der deutschen Elektroniker angelegt. So mancher Text legt nahe, dass kritische Punkte ausgeblendet wurden. Der Schriftsteller und Journalist Enno Stahl wählt gleich den vertrauten journalistischen Ansatz und führt in seinen Text zum Album „Tour de France“ ungeachtet des mangelnden Erkenntnisgewinns damit ein, dass er wegen einer Hüftarthrose zwar wie Ralph Hütter Fahrrad fährt, jedoch nur Mountainbike.
Dass es auch besser geht, zeigt Ulrich Adelt. Der Dozent für amerikanische Literatur und Autor eines Buches über Krautrock verdeutlicht, dass Kraftwerks Frühwerk eine „Geschichte des gezielten Vergessens“ ist, um den Mythos zu pflegen, dass die Band mit „Autobahn“ (1974) aus dem Nichts gekommen sei. Und Eckhard Schumacher, Germanist mit Arbeitsschwerpunkt Gegenwartsliteratur und Pop, weist darauf hin, dass man die Kraftwerk-Geschichte der 80er-Jahre zwar als Erfolgsgeschichte lesen kann – die Gruppe aber nach mit den Alben „Autobahn“ und „Computerwelt“ den Zenit überschritten hatte und „es danach eher bergab ging“. Dafür wurde in dieser Phase die Flamme, die Kraftwerk in den 70er-Jahren entzündet hatten, von anderen weitergetragen – indem sich die New Romantics diesseits und Afrika Bambaataa jenseits des Atlantiks auf das deutsche Quartett bezogen.
Ob beabsichtigt oder nicht: Jede Auseinandersetzung mit der Band, jeder Beitrag zum Thema Kraftwerk – nicht nur in diesem Band – fördert die Mythologisierung der Gruppe. Beiträge, in denen der Fan spricht, werden eher eine kürzere Halbwertszeit haben als solche, die aus einer objektiveren Perspektive verfasst wurden. Doch darf man die Heterogenität der Texte als willkommene Abwechslung deuten – und als Ganzes betrachtet ermöglicht diese Bestandsaufnahme Kraftwerk-Eleven einen umfassenden Einstieg und Kennern eine fundierte Vertiefung mancher Aspekte der Band, die seit einigen Jahren viel unternimmt, um über den sicheren Platz im musikalischen Kanon hinaus ein fester Bestandteil der Kunstwelt zu werden.
→ Bisherige Rezensionen zu Kraftwerk auf schallplattenmann.de
(Foto: C.W.-Leske-Verlag)

 [rating=4] Jazz – Jazz + Funk + Postrock + Trip-Hop + Electronics = Get The Bleesing.
[rating=4] Jazz – Jazz + Funk + Postrock + Trip-Hop + Electronics = Get The Bleesing.
 Kein TR-808 kam für dieses Album zu Schaden, vermerkt Ammar 808 auf der Albumrückseite ironisch. Anders als dressierte Affen kann man das kultige Rhythmusgerät aus den 80er-Jahren ohnehin nicht quälen. Und das macht er auch mit den Hörorganen nicht. Denn auch wenn seine Musik dringlich und tranceverdächtig ist: Die treibenden Rhythmen, die der tunesische Musiker aus seinem TR-808 holt, klingen grummelig warm, die Stimme ist stimulierend und das kollektive Händeklatschen feuert zusätzlich an.
Kein TR-808 kam für dieses Album zu Schaden, vermerkt Ammar 808 auf der Albumrückseite ironisch. Anders als dressierte Affen kann man das kultige Rhythmusgerät aus den 80er-Jahren ohnehin nicht quälen. Und das macht er auch mit den Hörorganen nicht. Denn auch wenn seine Musik dringlich und tranceverdächtig ist: Die treibenden Rhythmen, die der tunesische Musiker aus seinem TR-808 holt, klingen grummelig warm, die Stimme ist stimulierend und das kollektive Händeklatschen feuert zusätzlich an. 
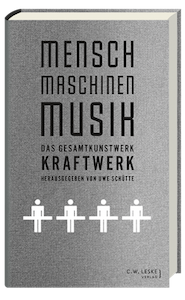 Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.
Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.
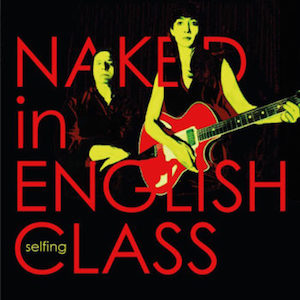 [rating=3] Alte Songs im Geist von gestern – schräg und poppig
[rating=3] Alte Songs im Geist von gestern – schräg und poppig
 Kann in andere Sphären tragen [rating=4]
Kann in andere Sphären tragen [rating=4]






 [rating=?] Anklänge an Progressive-, Jazz- oder Postrock wirken wie Wegweiser im unbekannten Terrain.
[rating=?] Anklänge an Progressive-, Jazz- oder Postrock wirken wie Wegweiser im unbekannten Terrain.
