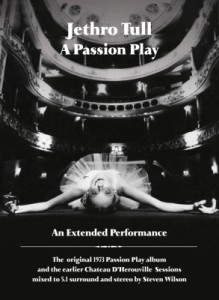[rating=4] Jazz – Jazz + Funk + Postrock + Trip-Hop + Electronics = Get The Bleesing.
[rating=4] Jazz – Jazz + Funk + Postrock + Trip-Hop + Electronics = Get The Bleesing.
Das Spannende an der aktuellen britischen Jazz-Szene ist, dass sie zu so vielen unterschiedlichen Ergebnissen kommt, die alle einen gemeinsamen Nenner haben: höchste musikalische Qualität. In Bristol, einst von Journalisten zur „Hauptstadt des Trip-Hop“ gekürt, gründete sich bereits 1999 das Quartett Get The Blessing. Ihre Musik fasst Elemente des Jazz, des Postrock und des Trip-Hop zusammen, vermischt akustische und elektronische Sounds und setzt dabei traditionelle Solo-Instrumente des Jazz, Trompete (Pete Judge) und Saxophon (Jake McMurchie) ein. Jim Barr am Bass und Clive Deamer an den Drums bereiten dafür das rhythmische Fundament. Die beiden sind keine Unbekannten: In derselben Funktion stehen sie auch mit Portishead auf der Bühne.
Get The Blessings siebtes Album „Bristopia“ zeigt das Quartett in Hochform. Die elf Tracks pulsieren energiegeladen und rhythmisch strukturiert, gleichzeitig mangelt es nicht an freien, improvisatorischen Sequenzen. Dabei wildern die vier selbstbewusst quer durch die Musikwelt. Es ist schon hauptsächlich Jazz, was sie auf dem Album bieten, aber mit der lässigen Attitüde einer Rockband und mit dem wohlüberlegten Einsatz von Sounds und Rhythmen aus verwandten und fernen Genres. Mitunter ist das Ergebnis sogar tanzbar (Huch!), es gibt aber auch immer wieder ruhige Momente. Für zusätzliche Akzente an der Gitarre sorgen Adrian Utley von Portishead und die Pedal-Steel-Gitarristin Margerethe Björklund.
[gallery link="file" ids="3837,3835,3836"]Das Album erscheint als CD, als Download und als limitierte LP auf orangefarbenem Vinyl, eine Augenweide und klanglich ebenso erhaben wie die digitalen Formate. Leider hat man bei der Vinyl-Ausgabe auf einen Download-Code verzichtet. Den erhält man allerdings, wenn man das Album auf der Bandcamp-Seite des Quartetts bestellt.
→ Get The Blessing Homepage
→ Get The Blessing auf bandcamp.com (mit Streaming- und Bestellmöglichkeit)
(Coverbild: Get The Blessing auf bandcamp.com; Vinyl-Bilder: Salvatore Pichireddu)