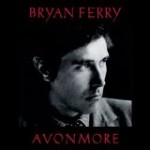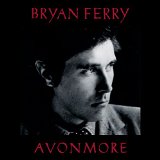[rating=3] Ein durchweg gutes Album
Der britische Sänger und Gitarrist Jonathan Jermiah legt mit „Oh Desire“ ein hörenswertes neues Album vor. Stilistisch durchaus uneinheitlich, wie man es von Jeremiahs bisherigen Veröffentlichungen kennt, pendelt auch dieses zwischen Folk-Jazz, Jazz, Pop und Soul. Deutliche Reminiszenzen an Otis Reddings unzerstörbaren Klassiker „Sitting on the Dock of the Bay“ liefert etwa sein „Smiling“, und bei „Walking on Air“ stellte sich die leise Erinnerung an „Solid Air“ von John Martyn ein. Jeremiah steht also auf den Schultern großer Musiker der sechziger und siebziger Jahre, was zusätzlich durch die analogen 16-Spur-Aufnahmen, mit denen die Titel aufgenommen wurden, akzentuiert wird.
Bleibt da Raum für eigenes? Sein Debüt 2011, „A Solitary Man“, wirkte bei aller Qualität seiner angenehmen Bariton-Stimme teils glatt und zerfahren, und mit dem Himmel voller Geigen, der beinahe in jedem Song dräute, auch überproduziert. Die etwas eigenwillige musikalische Mischung aus Big-Band-Jazz, Folk, Soft-Rock und seinem Aussehen, das wie eine Kreuzung aus Cat Stevens und modernem Hipstertum wirkt, schienen ihn nur bedingt zum Posterboy sensibler junger Menschen zu prädestinieren, die am virtuellen Lagerfeuer neben dem CD-Player Wärme suchten. Allein, der Erfolg wirkte bestätigend. Nun, einige Jahre später, sind die Big-Band-Anklänge weitgehend verschwunden, und die Geigen schluchzen ebenfalls dezenter. Nur im kurzen Eröffnungstitel und in „Rosario“ dominieren sie noch.
Geblieben ist die Liebe Jeremiahs zum klassischen Soul, zu Folk-Jazz und Soft-Pop, zur angejazzten Ballade. Hinzugekommen ist zudem eine feste Band, die bei der Umsetzung der vielfältigen musikalischen Ideen den Ton trifft. Und dieses Mal produzierte der Künstler selbst. Herausgekommen sind 13 Songs, die jedoch nicht alle im musikalischen Gedächtnis haften bleiben. Aber „Oh Desire“ ist, etlichen überraschenden Wechseln in der musikalischen Farbe zum Trotz, ein durchweg gutes Album geworden. Dem Thema Verlangen verhaftet, erzählt Jeremiah mit seiner angenehm tiefen Stimme Geschichten vom Tod der Eltern, Mythen der irischen Heimat („The Devils Hillside“), wie er diese Mythen aus den Erzählungen der Mutter als Kind kennen lernte oder vom hektischen, lauten Großstadtleben in London und der Sehnsucht nach dem vermeintlich einfachen Leben in der Natur. In „Rising Up“ räsonniert er darüber, daß – anders als in seiner Jugend – Bildung und Fleiß jungen Leuten keineswegs den Aufstieg ermöglichen oder auch nur erleichtern. Die sozialen Barrieren seien so hoch wie nie.
In der Summe seiner Musik und Texte bleibt sich Jonathan Jeremiah mit „Oh Desire“ treu, wenngleich einige behutsame, gleichwohl hörbare, Änderungen die neue Veröffentlichung prägen.