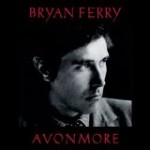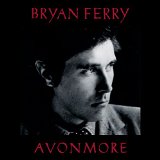„Ich nenn‘ mich jetzt Erfolg, dann habe ich in meinem Leben immer Erfolg“ singt Erfolg im Song „Erfolg“ auf seinem Debut-Album „Erfolg“. Ganz schön dick aufgetragen, möchte man meinen, aber keine Angst: der will nur spielen. Er ist Johannes von Weizsäcker, Berliner Musiker, der statt „Rock“ im weiteren Sinne auf seinem Erstling, ja was eigentlich genau macht? Chanson? Kabarett? Pop? Das Erbe von Andreas Dorau und Max Goldt verwalten? Hier können wir nur mit einem entschiedenen „Vielleicht, vielleicht auch nicht“ antworten. Der beste Weg zum Erfolg ist, zunächst unbefangen seine Platte zu hören. Schnell wird klar, dass die angenehme – im weiteren Sinne – Popmusik sich dem Sprechgesang von Weizsäcker unterordnet. Wo dessen stimmliche Qualitäten nicht weiter reichen, hilft „“Der beste Damenchor aller Zeiten““, der natürlich genau das nicht ist, sondern eine muntere Ansammlung sangeskundiger Damen im Berliner Popformat. Das macht aber überhaupt nix, denn die Miniaturen oder Moritaten Weizsäckers, pardon: Erfolg, handeln von Leuten wie dem „Brillenmann“, der im angesagten Hauptstadtchic allerorten bei Konzerten, Lesungen oder Vernissagen Gesichtspflege betreibt. „Mausmann“ erweitert die Betrachtung prekärer Existenzen um einen zeitweiligen Fondsmanager, der gerne kocht, im Fernsehen zu Ruhm kommt und sein Leben fern aller deutschen Kochtöpfe beschließt und der „Gute Mann“ wird mit Verve besungen, jedoch aus ironischer Sichtweise. Das alles ist gut gemacht und beobachtet, aber trotzdem nur Musik für „gewisse Stunden“, die aber in jenen genau richtig ist. So ist das Leben, zumindest jenes von Teilen des Berliner Szenebiotops, das allen Tendenzen der Gentrifizierung zum Trotz – oder gerade deswegen? – wächst und gedeiht. Angenehm daran, daß das gewisse Pathos und – seien wir offen – die bisweilen große Berliner Schnauze hier fehlen, sondern stattdessen hintergründiger Humor, sanfte Ironie, leichte Melancholie und geschärfte Beobachtungsgabe dominieren. Zwar etwas textlastig, das Ganze, aber „mal was anderes“ aus dem kleinen deutschsprachigen Eck im Pop-Universum.[rating=3]