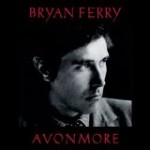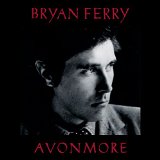[rating=2] Erwachsener, eigenständiger, erdverbundener
[rating=2] Erwachsener, eigenständiger, erdverbundener
Drei Jahre sind vergangen, seit Jack Savoretti sein letztes Album veröffentlicht hat. Zwischenzeitlich hatte er nach eigenem Bekunden mit dem Gedanken gespielt, die Musik an den Nagel zu hängen. Die Gründe, die er dafür anführt, kommen einem bekannt vor: Ärger mit Managern und Plattenfirmen, Karrierepläne, die nicht aufgehen, die wirtschaftlich unsichere Existenz als Künstler. Den Sinneswandel, der ihn dazu bewogen habe, es nochmals zu versuchen, begründet er so: Seine Entscheidung, die professionelle Musikerlaufbahn aufzugeben, habe den Erfolgsdruck von ihm genommen. Die so gewonnene neue Freiheit habe zu einem Kreativitätsschub geführt. Mit anderen Worten: Savoretti komponierte fleißig und traf in der Zwischenzeit die für ihn richtigen Leute: Etliche Songs auf „Written in Scars“, etwa der erste Titel „Back to Me“, entstanden in Zusammenarbeit mit Samuel Dixon, der auch mit Adele arbeitet. Diese Songwriting-Partnerschaft wirkte sich fruchtvoll auf Savoretti aus, denn er änderte seine Arbeitsweise. Am Anfang habe dieses Mal der Rhythmus und der Sound gestanden, erst danach seien Strukturen entstanden.
Das ist sicherlich keine gewöhnliche Herangehensweise für einen Singer-Songwriter, und sie führte denn auch zu einem hörbar anderen Klangbild. Klang Savoretti am Anfang seiner Karriere noch ein wenig wie eine Art Quersumme des romantischen Troubadours, so wirken Stimme und Kompositionen nunmehr erwachsener, eigenständiger, erdverbundener. Die unverwechselbare warme, kratzige Stimme hat er behalten. Aber auch diese scheint nunmehr gereifter, wenngleich immer noch mädchenschwarm-tauglich.
Musikalisch geht Savoretti mit der neuen Platte trotzdem keine wirklichen Risiken ein. Eingängige Popmelodien paaren sich mit Country und Soul-Elementen in mitunter etwas forciertem Rhythmus. Das sei von Profis clever ür die junge weibliche Zielgruppe hergestellt, könnte man spotten. Natürlich singt Savoretti von unerfüllter Sehnsucht und vom Wunsch, die Geliebte möge nach Hause kommen, und er singt auch vom Freiheitswillen jedes Individuums oder von der großen Kraft der Liebe. Dazu lässt der Produzent an passender Stelle ein paar Geigen schmelzen oder er bringt einen gefühlvollen Chor im HIntergrund.
Ist das zuviel der Romanze? Vielleicht, aber der Mann tritt ja nicht an als der zornige Prophet aus dem brennenden Dornbusch. Und: ja, auch männliche Hörer werden dabei ganz gut unterhalten, solange sie keine komplexen Arrangements oder Soundtüfteleien erwarten. Das ist gut gemachter Pop – nicht mehr, nicht weniger. Jack Savoretti müsste also gar nicht so traurig in die Zukunft blicken, wie er das auf dem Cover von „Written in Scars“ macht.